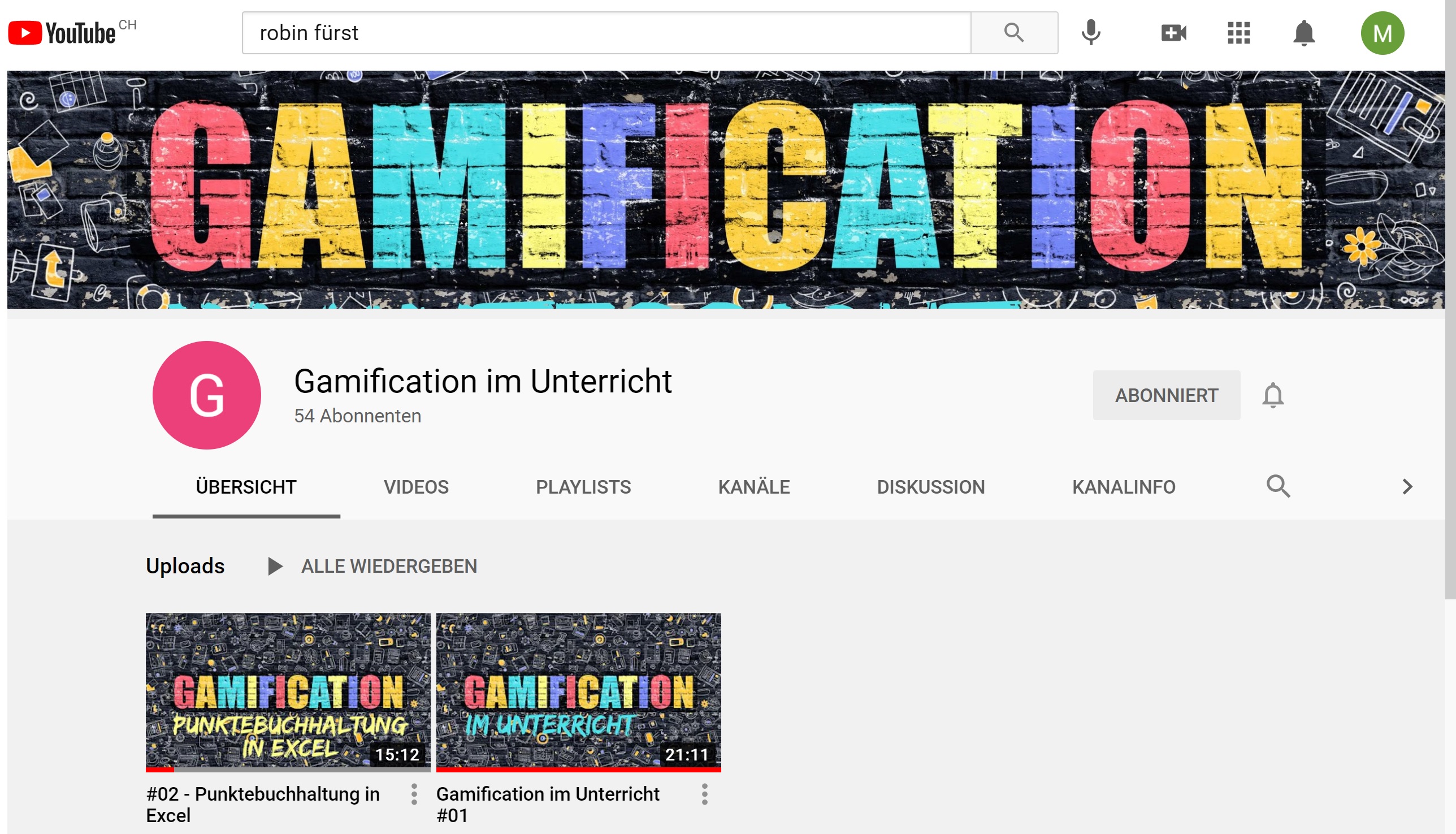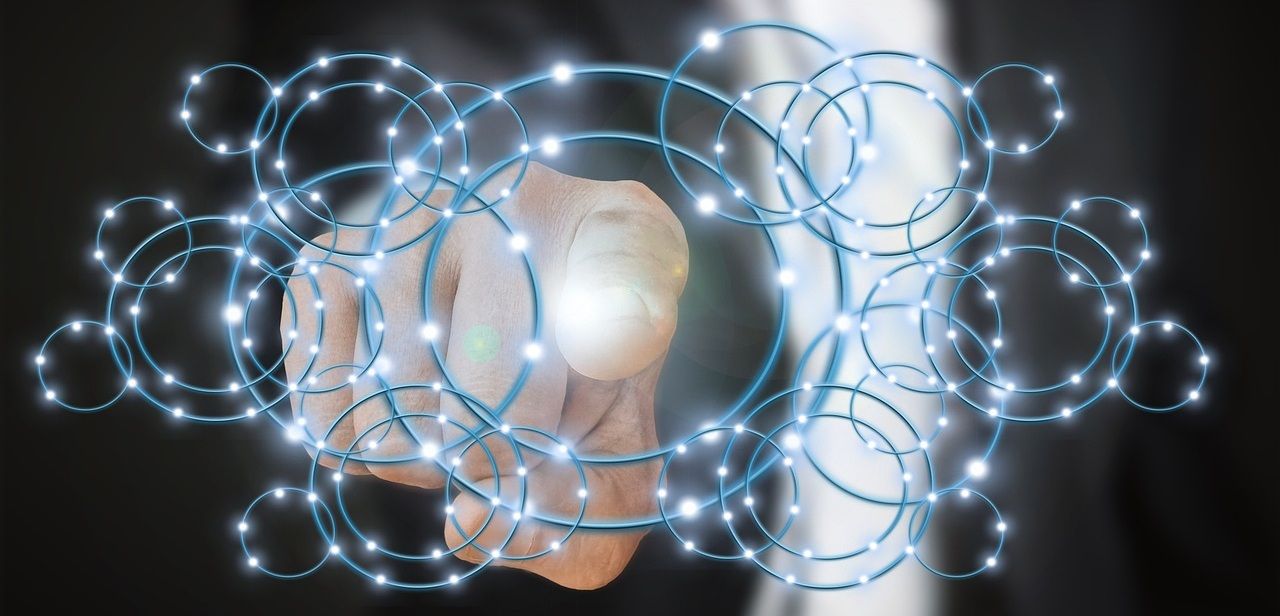Der explorative Prozess des Lesens
- Projektleitung: Thomas Fähndrich (Geschichte) und Klaus Nürnberg (Deutsch)
- Institution: Kantonale Maturitätsschule für Erwachsene, Zürich
- Kontakt: klaus@nuernberg.ch
Durch ein Flipped-Classroom-Konzept werden SuS gezielt beim Lesen von überschaubaren, anspruchsvollen Texten aktiviert. Dabei müssen sie Selbstverantwortung übernehmen. Der Lernprozess wird durch einen «blended learning» Ansatz begleitet, die Lernerkenntnisse gemeinsam überprüft, revidiert und schliesslich im digitalen Raum abgelegt.
Beschreibung
Die Studierenden bereiten sich selbständig auf den Unterricht vor, indem sie die über das LMS Moodle gelieferten kurzen literarischen Texte lesen, aufgrund ihrer Erkenntnisse aus der Lektüre ein bestehendes Raster ausfüllen und ergänzende eigene Bemerkungen hinzufügen.
Der Lernprozess wird durch einen «blended learning» Ansatz begleitet. Die Erkenntnisse der SuS werden gemeinsam überprüft, revidiert und schliesslich im digitalen Raum abgelegt.
Damit ist gewährleistet, dass die SuS durch das «flipped-classroom-Konzept» gezielt aktiviert werden und Selbstverantwortung übernehmen müssen.
Der digitale Lernraum ist dazu geeignet, Studierende von einem angeleiteten und geführten Lernen schrittweise zu einem selbstverantwortlichen Lernen zu führen.
Didaktisch-methodisches Konzept
Wir arbeiten mit zehn Texten. Sieben davon lassen sich eindeutig einer Textsorte zuordnen, drei Texte nicht. Wir arbeiten mit kurzen Texten, die überschaubar, aber anspruchsvoll sind. Der Schwerpunkt liegt auf dem explorativen Prozess des Lesens.
Die Leitfragen für jeden der zehn Texte lauten: «Was zeichnet den Text besonders aus, was ist das Charakteristische? Was unterscheidet den Text von den bisher im Rahmen des Projektes besprochenen Texten?».
Die Studierenden lernen, in einem Text Merkmale zu erkennen, die Alleinstellungsmerkmale eines Textes sind, und solche, die ihn einer bestimmten Textsorte zuordnen.
Jeder der zehn Texte wird in vier Schritten bearbeitet:
1. Vorbereitung / flipped classroom:
Die Studierenden lesen die vorgelegten Texte.
Sie erhalten zu jedem Text ein elektronisches Raster mit Fragen und Beobachtungsaufgaben und halten darin ihre Schlussfolgerungen und Erkenntnisse fest.
2. Auswertung / blended Learning:
Die ausgefüllten Raster dienen als Grundlage für ein Klassengespräch.
Die SuS können die Antworten und Einschätzungen der ganzen Klasse sehen und mit ihren eigenen vergleichen. So entsteht ein Bild, bei welchen Punkten Einigkeit herrscht und wo die Beobachtungen, Schlussfolgerungen und Erkenntnisse abweichen.
Im Klassengespräch werden die Differenzen besprochen und so weit wie möglich geklärt. Da alle SuS ihre Antworten und Einschätzungen eingetragen haben, können die SuS und die LP gezielt nachfragen und Erklärungen und Begründungen einfordern. Auf diese Weise können SuS aktiviert werden, die sonst im mündlichen Unterricht wenig aktiv sind.
3. Anwendung / Transfer:
Die Studierenden schreiben insgesamt fünf eigene kurze literarische Texte. Sie orientieren sich dabei an den zehn Texten des Korpus. Sie schreiben z.B. eine Fabel, eine Parabel und eine Kurzgeschichte.
Sie setzen in jedem Text mindestens drei Elemente um, die z.B. für eine Fabel unabdingbar sind. Dabei stützen Sie sich auf ihre eigenen Erkenntnisse (Schritt 1, flipped classroom) und das Klassengespräch (Schritt 2, blended learning). Bei der Wahl spezifischer Merkmale sind sie frei (z.B. Ort der Handlung, Zeit der Handlung).
Die Texte werden im Lernraum moodle publiziert. Studierende und Lehrpersonen lesen sie und geben sich Rückmeldungen zu den Texten. Aufgrund dieser Rückmeldungen können die SuS ihre Texte weiterentwickeln.
4. Prozess sichern/Beurteilung der Arbeit:
Wir denken in folgende Richtungen: Beurteilung der fünf Texte durch die Lehrperson (klassisch)
Beurteilung durch Mitstudierende und die Lehrperson (nach einem Raster) Beurteilungskriterien: die Idee hinter dem Text, Erkennbarkeit der spezifischen Merkmale der Textsorte, die Weiterentwicklung aufgrund der Rückmeldungen, die Beiträge im Unterricht, die Erkenntnisse in den Rastern (Schritt 1).
Wirkung
Um der Heterogenität in Bezug auf die Lesekompetenz zu begegnen, werden die SuS individuell bei ihrer Lesekompetenz und ihrem Leseverständnis abgeholt. Studierende mit unterschiedlichen Bildungs-, Sprach- und Kulturhintergrund können sich beim Erlernen der Inhalte mehr Zeit lassen und werden nicht überfordert. Studierende mit Vorkenntnissen können die Inhalte kurz lesend erfassen und wenden sich spezifischen Aspekten der Texte zu. Dies wirkt motivierend, da die Studierenden sofort den adäquaten Ansatzpunkt zum Lernen finden können (John Hattie / Klaus Zierer).
Die grosse Menge an Lernstoff muss nicht im Klassenzimmer vermittelt werden. Bei klassischem Unterricht würden zwingend ungelöste Probleme zurückbleiben.
Der zur Verfügung stehende Präsenzunterricht kann für die wichtigen Fragestellungen der Studierenden, für Übungen und zur Konsolidierung der Inhalte verwendet werden.
Ziel ist es, mit dem Klassenunterricht die Inhalte abzuschliessen und soweit es sinnvoll ist, ein gemeinsames Niveau der Lesekompetenz anzustreben, nachdem die Lesekompetenz stufenweise erweitert wurde. Weitere Übungen im Sinne von Hausaufgaben sind nicht vorgesehen.
Dieser Ansatz bietet neue Möglichkeiten der Beurteilung. Das gängige Schema, dass der Stoff zuerst gemeinsam erarbeitet und dann in einer Klassenarbeit geprüft wird, kann durchbrochen werden. Der Prozess wird beurteilt: Die Einträge in den Rastern, die mündliche Arbeit bei der Besprechung der Raster, die von den SuS verfassten Texte, die Rückmeldungen auf die selbst verfassten kurzen literarischen Texte der Mitstudierenden.
SAMR-Modell
Das Projekt ist im SAMR Modell auf den Stufen «Modification» und «Redefinition» angesiedelt, da die Studierenden ihr affektives Leseverständnis reflektieren, stufenweise erweitern und ihre Fortschritte dokumentieren. Der Lerneffekt wird verstärkt, da die SuS auf zwei Ebenen miteinander kommunizieren – über ihre selbst verfassten Texte und indem sie Ihr Leseverständnis mit dem anderer SuS vergleichen.
Durch den «flipped classroom» Ansatz wird ein neuer Anreiz realisiert. Es lässt sich erkennen, ob die Studierenden vorbereitet sind und in welcher Qualität und Quantität sie die Aufgaben bearbeiten. Es lässt sich auch erkennen, welche Aufgaben besondere Probleme erzeugt haben. Darauf kann im Unterricht individuell eingegangen werden. Abschliessend lassen sich Aufgaben erkennen, die ungeeignet oder nicht mehr zeitgemäss sind. Damit lässt sich die Qualität des Unterrichts erhöhen.
Bemerkung:
Aufgrund einer vorzeitigen Pensionierung konnte das Projekt nicht mehr ausgearbeitet und realisiert werden. Sollte die Projektidee von anderen aufgenommen werden, würde uns das freuen.